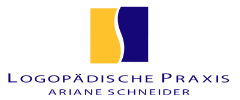Sie wirken beruhigend, kommunizieren anders als Menschen, fordern Kontaktaufnahme und Zuwendung, beim Streicheln werden Glückshormone wie Endorphine und Oxytocin ausgeschüttet: Therapiebegleithunde. Seit 2012 arbeiten wir in Gettorf tiergestützt. Da gibt es Pepe, ein Golden Retriever-Hovawart-Mix im Team mit Praxis-Inhaberin Ariane Schneider, und Stine, eine Retriever-Labrador-Hündin im Team mit Andrea Peltzer. Pepe zeichnet sich besonders durch seine sehr ruhige, ausgeglichene und geduldige Art aus. Er lässt sich gerne zum gemeinsamen Spielen einladen, mag es, Kinder auf dem Rollbrett zu ziehen und findet es toll, Trommel und Klavier zu spielen. Stine bevorzugt es, mit den kleinen Patienten Spiele zu spielen. Sie kann richtig gut Sachen finden, die Kinder für sie verstecken und liebt es, wenn sie ihre Kunststücke vormachen darf.
Aber wieso ein Therapiebegleithund?
Als Logopäden haben wir überwiegend mit Menschen zu tun, die Probleme in ihrer Kommunikation haben. Das Sprechen fällt ihnen schwer, die Aussprache ist nicht deutlich, es fehlen Wörter oder die passenden Wörter fallen nicht ein. Nicht selten machen Menschen in ihrem Umfeld damit negative Erfahrungen, sind in ihrer Teilhabe im Alltag und Partizipation eingeschränkt, ziehen sich zurück. Ein Therapiebegleithund jedoch reagiert wertfrei. Er geht freudig und ohne Vorurteile auf Menschen zu. Ihm ist es gleich, wie alt, krank oder eingeschränkt die Menschen sind. Hunde bleiben geduldig, auch wenn sie ihr Gegenüber nicht sofort verstehen. Sie reagieren viel mehr auf Körpersprache, Mimik und Augenkontakt als auf Sprache. Sie regen die Sprechfreude an, sorgen für Motivation und gute Stimmung. In der Praxis lassen sich im Einsatz mit den Hunden positive und hilfreiche Effekte beobachten.
Dieser Effekt lässt sich am Beispiel der sechsjährigen L. mit der Diagnose selektiver Mutismus anschaulich beschreiben. Selektiver Mutismus bedeutet, dass betroffene Menschen nur mit bestimmten Personen oder in bestimmten Situationen sprechen. Die kleine Patientin L. sprach nur zu Hause mit ihren Eltern, Geschwistern und Großeltern. Kam Besuch, schwieg sie. In der Schule oder in der freien Spielzeit reduzierte sich ihr Sprechen auf Ja-Nein-Äußerungen. In der logopädischen Therapie jedoch veränderte sich das Schweigen durch die Anwesenheit des Hundes. L. gab Pepe zunächst einsilbige Befehle, begleitet mit Mimik und Körpersprache. Später folgten verbale Aufträge, die er gerne, mit Freude und Geduld für das Kind durchführte. Auch wenn außerhalb des Therapieraums geübt wurde, sollte Pepe nun als tierischer Begleiter dabei sein. So fiel es L. leichter, mit fremden Personen in Kontakt zu treten und zu kommunizieren. Heute entwickelt sie sich großartig und hat viel mehr Freude an der Kommunikation, besonders in der Schule.
Aber auch in der Behandlung von Erwachsenen mit neurologisch bedingten Sprachstörungen oder dementiellen Prozessen bemerken wir immer wieder, dass sich eine höhere Anzahl von verbalen und nonverbalen Interaktionen beim Einsatz eines Therapiebegleithundes feststellen lässt.
Ist die Anwesenheit des Hundes in der Therapie vom Patienten nicht gewünscht, verbleiben die Hunde auf ihren zugewiesenen Plätzen oder verlassen den Raum und machen eine kleine Pause.
Hier können Sie unsere vierbeinigen Team-Mitglieder näher kennenlernen: